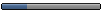heute Mittag wurde feierlich im Besein zahlreicher Führungskräfte sowie dem Vorsitzenden des Vorstands von DB Schenker Rail, Alexander Hedderich, das Center for Rail Logistics (in Form eines Büroraumes) eingeweiht. Grundsätzlich geht es darum, die Verbindung zwischen universitärer Lehre und der Praxis im Betriebsalltag wieder zu verstärken und natürlich auch darum, qualifiziertes, motiviertes Personal für DBSR zu gewinnen.
Die offizielle Ankündigung der Professor für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr dazu:
Hedderich stellte zu Beginn in etwa 45 Minuten DB Schenker Rail vor, wobei er zunächst auf seine persönliche wissenschaftliche Laufbahn einging und da auch schon eine Verbindung zur TU Dresden hatte: Als 1965 in Wetzlar Geborener hat er von 1985 bis 1991 an der Justus-Liebig-Universität in Gießen Wirtschaftswissenschaften studiert und anschließend als Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Gerd Aberle promoviert. Da Aberle in dieser Zeit auch in Dresden als Gründungsdekan unserer heutigen Fakultät tätig war, sei er auch mit der Korrektur von Prüfungen des Grundstudiums betraut gewesen. Die Planungen Aberles, die Hochschule für Verkehrswesen zu einer Europäischen Hochschule für Verkehrswesen zu machen, hätten sich zwar nicht erfüllt, doch sei in der heutigen Ausrichtung der Studiengänge als Fakultät der TU Dresden durchaus vieles von den damaligen Konzepten wiedererkennbar. So sei auch geplant gewesen, das Grundstudium in Kooperation mit der TU durchzuführen und erst im Hauptstudium allein die Ausbildung zu übernehmen.Moderne Methoden der Wissenschaft für den Schienengüterverkehr der Zukunft: Stärkung bahnaffiner Logistikketten
Die Technische Universität Dresden und DB Schenker wollen künftig ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Dazu haben beide Seiten beschlossen, ab 2014 eine mehrjährige Kooperation zu begründen.
Die feierliche Unterzeichnung des Kooperationsvertrages findet am 6. Dezember 2013 an der TU Dresden statt. Dazu wird Dr. Alexander Hedderich, Vorsitzender von DB Schenker Rail, die Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“ besuchen und sein Unternehmen in einem Gastvortrag vorstellen.
Einen Schwerpunkt der Kooperation wird die Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in die Praxis bilden. Dadurch soll der Schienengüterverkehr für moderne bahnaffine Logistikketten gestärkt werden. Das bedeutet konkret, dass sich der Schienengüterverkehr besser an die logistischen Anforderungen der Wirtschaft anpasst und somit insgesamt einen höheren Verkehrsanteil gegenüber der Straße erreicht. So werden sich weitere Projekte mit dem Einsatz neuer technischer Systeme in den Bahnbetriebsprozessen sowie dem Ausbau des kombinierten Verkehrs beschäftigen.
Neben gemeinsamer Forschung spielt jedoch auch die fachliche Weiterqualifikation der Mitarbeiter auf beiden Seiten eine entscheidende Rolle. Hierzu sollen entsprechende Weiterbildungsprogramme entwickelt werden. Darüber hinaus fördert DB Schenker die Promotionsvorhaben von Doktoranden an der TU Dresden.
Vor allem werden auch die Studierenden von der Zusammenarbeit profitieren, indem beispielsweise interessante Exkursionen, Praktika und Abschlussarbeiten angeboten werden. So können die künftigen Fachkräfte ihr erlerntes Wissen direkt in der Praxis anwenden und dabei auch das Unternehmen DB Schenker als attraktiven Arbeitgeber kennenlernen.
Seitens der TU Dresden wird die neue Kooperation von der Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr betreut. Sie fungiert als sogenannte Ankerprofessur für ein neu einzurichtendes „DB Schenker & TU Dresden Center for Rail Logistics“. Dafür wurden bereits Forschungsthemen mit mittel- und langfristigem Fokus identifiziert. Ziel ist die Unterstützung von DB Schenker auf dem Weg zu effizientem und modernem Schienengüterverkehr der Zukunft.
Auf Seiten DB Schenker wurde das Center durch den Bereich Business Excellence als Teil der Strategie des DB Ressorts Transport und Logistik entwickelt. Die Kooperation wird dort in enger Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen von DB Schenker geführt.
Journalisten sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen:
6. Dezember 2013, 13 Uhr, Potthoff-Bau, Raum 112, Hettnerstr. 1.
13 Uhr: Vortrag zum Thema „Strategie von DB Schenker Rail im europäischen Transportmarkt“ von Dr. Alexander Hedderich, Vorstandsvorsitzender der DB Schenker Rail Europe AG.
Gegen 14 Uhr: Vertragsunterzeichnung in Anwesenheit des Prorektors für Forschung der TUD, Prof. Gerhard Rödel, des Dekans der Fakultät für Verkehrswissenschaften, Prof. Hartmut Fricke, sowie des Mitglieds des Hochschulrats, Prof.Knut Löschke.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, mit Dr. Alexander Hedderich und den Vertreter der Universität ins Gespräch zu kommen.
Hedderich ist seit 1999 bei der DB AG tätig, zunächst in der Holding unter Mehdorn in verschiedenen Bereichen, ab 2004 dann für die Konzernstrategie zuständig. 2009 wechselte er dann als Vorstand zu DB Schenker Rail.
Bei der Präsentation der DBSR erläuterte Hedderich, dass die DBSR als größte Güterbahn Europas (jeder vierte Güterzug in Europa sei ein DB-Zug) etwa ein Zwölftel des Konzerns ausmache (auf was bezogen, habe ich mir nicht notiert, ich gehe daher mal vom Umsatz aus). Das Ergebnis dieses Geschäftsbereichs sei derzeit noch nicht zufriedenstellend, da die Marge nur bei 1,3 % liege. Vergleichend zu den Mitwettbewerbern kommentierte er das mit: „Wir haben ne 4-, aber die anderen sind durchgefallen“. Die 2007 in Frankreich "auf der grünen Wiese" gegründete Tochter EuroCargoRail sei die am schnellsten wachsende Güterbahn in Europa und schreibe im Gegensatz zur Güterverkehrssparte der SNCF schwarze Zahlen, wohingegen der Güterverkehr der SNCF schon seit 30 Jahren (!) nicht mehr kostendeckend sei. In Schlesien sei man inzwischen stärker als PKP Cargo, in Großbritannien wie auch in den Niederlanden größte Güterbahn (Anm.: wenig verwunderlich, wenn man mehr oder weniger die Güterverkehrssparte der ehemaligen Staatsbahn kauft). In Rumänien und Bulgarien habe man aus dem Stand heraus, oftmals mit Gebrauchtmaterial aus dem Westen, einen Marktanteil von 10-15 % erreichen können.
Auf dem Weg zu einer europäischen Güterbahn fänden auch alle Führungskräfteveranstaltungen in Englisch statt, was insbesondere hierzulande zunächst zu Protest geführt habe, aber inzwischen akzeptiert sei. Titel habe man im Unternehmen abgeschafft (weswegen ich hier jetzt auch keinen schreibe), es gebe eine "Doktorkasse", die am heutigen Tag an der TU sicherlich wieder gut gefüllt hätte werden können: „[...]Investitionen von 39 Mio. EUR, wir haben jetzt die ersten 93 EUR dank Ihnen“ (an Prof. König gerichtet).
Bei der Auflistung der Märkte erwähnte er den Intermodalmarkt als stark wachsend, der auch wieder nicht bahnaffine Güter auf die Schiene brächte und jährlich für 1 Mrd. EUR Umsatz sorge, der Automotivbereich liege bei 800 Mio. EUR, die weiteren Bereiche hab ich mir nicht rechtzeitig notiert. Problematisch für den Güterverkehr sei, dass die Industrieproduktion in der Eurozone wieder auf dem Niveau von 2009 gelandet sei, nachdem es zwischenzeitlich wieder einen Anstieg gegeben habe. Man liege damit auf 86 % des Niveaus von 2007. Das klassische Geschäftsmodell der Güterbahnen sei in einem solchen Umfeld jedoch nicht mehr zu fahren, denn historisch hätten sich die Bahnen stets auf den Rücken- oder Gegenwind aus der Produktion verlassen können. Trotzdem bleibe der Schienengüterverkehr ein Wachstumsmarkt. Der wichtigste Güterverkehrsstrom in Europa sei weiterhin zwischen Deutschland und Italien, wo man topografisch bedingt auch einen überproportionalen Marktanteil habe. Trotzdem sei die Situation bei einer schwächelnden Produktion in Italien natürlich schwierig.
Bei der Preisgestaltung sei wenig möglich, man rechne in den nächsten Jahren mit jährlich um 3-4 % wachsenden Personalkosten. Gleiches gilt für die Energiekosten, die bereits in den vergangenen Jahren jeweils um die 4 % p.a. gewachsen seien. Die Industrie erwarte jedoch jährlich 1-2 % fallende Transportpreise und eine Transportentscheidung pro Bahn sei zu 80 bis 90 % vom Preis abhängig.
Anschließend ging es um die DB-Strategie 2020 in Bezug auf DBSR: Nochmals Bezug nehmend auf die internationale Ausrichtung wies er darauf hin, dass bereits 2000 60 % aller auf der Schiene transportierten Waren grenzüberschreitend unterwegs gewesen seien. Die Eisenbahn habe jedoch historisch immer auf Staatsebene funktioniert. Verkehrsangebote wie der Zug zwischen London und Wroclaw in Polen hätten früher bis zu sechs verschiedene Betreiber benötigt, was damit quasi unmöglich gewesen sei. Heute könne alles aus einer Hand geboten werden. Und das Transportbedürfnis auf dieser Relation sei durchaus vorhanden gewesen.
Im Personalsektor werde es in den nächsten Jahren eine deutliche Verjüngung geben müssen. So seien bei DBSR 49 % des Personal über 50 Jahre alt, gerade beim Fahrpersonal. Schlimmer sehe es nur noch in der Instandhaltung aus, wo es selten jemand unter 52-53 Jahre gebe, so dass sich die wenigen Jungen natürlich auch nicht wohlfühlten.
Entsprechend wurde auch das Traineeprogramm präsentiert und er hoffe, in den nächsten Jahren natürlich verstärkt auch Absolventen aus Dresden begrüßen zu können und stellte dabei die Zahl von fünfen in den Raum.
Weiteres Thema war dann auch die Lärmproblematik, wo präsentiert wurde, dass man bis 2015 50 % und 2020 100 % des eigenen Fuhrparks auf die Flüsterbremse umgerüstet haben wolle. Da man jedoch auch viele Wagen von Verleihern einsetze, könne das natürlich keine volle Wirkung haben. Bezogen aufs Rheintal sagte er: „Da heißt es Weltkulturerbe, aber die Eisenbahn ist auch schon seit 180 Jahren da“.
Noch Luft nach oben sah er auch im eigenen Haus in Sachen Umweltverantwortlichkeit. Eine entsprechende Haltung sei wichtig, gerade auch in der Führungsebene und fange schon damit an, nicht benötigtes Licht und nicht benötigte Computer einfach auszuschalten.
In der anschließenden kurzen Fragerunde wurde noch folgendes erwähnt:
Die klassischen Massentransportgüter wie Kohle würden durch die Energiewende wegfallen, aber auch, weil neue Kraftwerke oft direkt in Häfen errichtet würden, wo dann die Importkohle direkt von den Schiffen in die Bunker gekippt werden können. Dieser Geschäftsbereich bringe mit 1,3 ct/tkm auch nicht so viel ein, könne aber auch nicht durch wachsende Bereiche wie Automotive, wo 9-10 ct/tkm normal wären, kompensiert werden. Die Verkehrsleistung in tkm würde sich dadurch auch verändern, wobei damit nicht unbedingt weniger gefahren werde, sondern eher mehr.
In Sachen Einzelwagenverkehr betonte er die Mitgliedschaft in der Kooperation XRail. Die Industrie in Deutschland brauche den EWV, Industrien wie die Stahlindustrie könnten ohne ihn hierzulande nicht existieren, da um die 50 % des Warenausgangs per Bahn erfolgten. Das Produktionsmodell Netzwerkbahn ziele auch darauf ab, in den letzten zwei Jahren seien bereits 87 Blockingskonzepte umgesetzt worden, womit mehrere Mio. EUR hätten eingespart werden können. Mit Blick nach Frankreich und den dortigen Rückzug des EWV sagte er, die SNCF verabschiede sich damit längerfristig insgesamt vom Schienengüterverkehr.
Als Beispiel für neue Verkehre auf neuen Relationen nannte er noch den Zug mit HP-Geräten aus China, der zweimal wöchentlich verkehre und der jeweils einen reinen Versicherungswert von 68 Mio. EUR habe. 30 % der verkauften HP-Geräte in Europa würden derzeit per Bahn angeliefert.
Soweit die aus meiner Sicht interessantesten Fakten der Veranstaltung, die ich hoffentlich richtig wiedergegeben habe. Ich konnte mich dann, wenn auch nur relativ kurz, auch etwas direkt mit ihm unterhalten und man wird sich an der TU sicher nicht das letzte Mal gesehen haben, denn so eine Kooperation sollte ja auch mit Leben gefüllt werden, auch direkt aus dem Vorstand heraus.
Grüße, Hannes